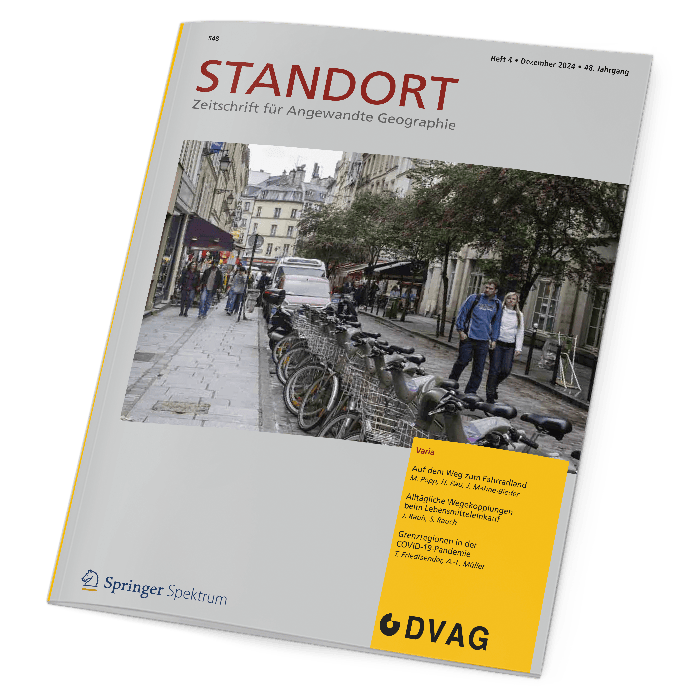Klimakrisen-Tagebuch #7:
Die COP der falschen Lösungen
Die COP29 in Aserbeidschans Hauptstadt Baku sollte der Klimagipfel der Finanzen werden, aber es kam anders: Gleich zum Auftakt setzten zwei wichtige Männer den Ton: Ilham Alijev, Präsident des Gastgeberstaates Aserbeidschan, dessen Haushalt zu 2/3 von den Einnahmen aus dem Export von Öl und Gas abhängt, erklärte auf dem Gipfel der Staatschefs, dass Öl und Gas „Geschenke Gottes“ seien, und Sitzungspräsident Muktar Babayew winkte den Entwurf des Beratenden Komitees zu Artikel 6 über die Kohlenstoffmärkte ohne weitere Rücksprache mit den Mitgliedsstaaten durch. Der Klimagipfel zählte rund 65.000 Teilnehmer aus 198 Staaten; die größte Delegation auf der COP bildeten über 1700 Öl- und Gaslobbyisten.
Die wichtigsten Ergebnisse:
Das Neue Gemeinsame Quantifizierte Finanzziel (NCQG)
Bis 2035 sollen die Industrieländer ihre jährlichen Zahlungen an Entwicklungsländer aus öffentlichen und privaten Mitteln auf 300 Milliarden US-Dollar erhöhen. Insgesamt sollen aus weiteren Quellen jährlich 1,3 Billionen Dollar an Klimafinanzierung fließen, u.a. über multilaterale Entwicklungsbanken, Einnahmen aus dem Kohlenstoffmarkt und von reicheren Schwellenländern und Ölstaaten, die dies auf freiwilliger Basis tun (China hat bereits über 25 Mrd. $ an andere Entwicklungsländer gegeben); es gibt aber keine klaren Vorgaben, welche Quelle wieviel bringen soll. Die Entwicklungsländer hatten – basierend auf zahlreichen Studien – 1,3 Billion $ jährlich gefordert mit festen Unterzielen für Treibhausgasreduktionen, Anpassung und Verluste und Schäden.
Auch stellen die 300 Milliarden $ keine Verdreifachung des alten Zieles von 100 Milliarden $ dar, denn die Anteile an öffentlichen Mitteln und die an Krediten darin sind nicht festgelegt. Deshalb befürchten die Entwicklungsländer zurecht, durch einen höhen Anteil von Krediten noch tiefer in die Verschuldungsfalle zu sinken; dies gilt erst recht für die in Aussicht gestellt weitere Billion $. Und diese beiden Ziele sollen ja erst 2035 erreicht werden. Sprecher von Entwicklungsländern und aus der Zivilgesellschaft warfen den Industrieländern „Flucht aus der Verantwortung“ vor.
Weitere Finanzziele
Die Mittel für Anpassung sollen deutlicht erhöht werden, allerdings auch hier ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Für Loss & Damage wurde nur festgestellt, dass es eine große Lücke zwischen Bedarf und bis zugesagten Mitteln gibt. Der L&D-Fonds enthält jetzt durch ein paar weitere Zusagen während des Gipfels 759 Millionen $.
Die Emissionsminderung
Der „Übergang weg von den fossilen Energien“, den die Industriestaaten als das Hauptergebnis der COP28 gefeiert hatten, wird auf Druck Saudi-Arabiens hin im Abschlußdokument namentlich überhaupt nicht mehr erwähnt; Gas wird als Übergangstreibstoff bezeichnet.
Der Kohlenstoffmarkt
In den Artikeln 6.2, 6.4. und 6.8 werden einige zusätzliche Kriterien für die Anerkennung von Kohlenstoff-Projekten genannt, allerdings kritisieren NGO-Vertreter diese als nicht ausreichend: So werden sogenannte CDM-Projekte vor allem für Waldschutz ohne neue Prüfung ihrer Zusätzlichkeit übernommen (dabei war dies eine Hauptkritik in unabhängigen Studien zu Waldprojekten); desweiteren könnten Staaten CO2 -Zertifikate von anderen Staaten ungeprüft übernehmen, sofern keine Ungereimheiten darin aufgetaucht sind. Die Standards für Umwelt- und Menschenrechte seien generell noch zu schwach und vor allem können sogenannte removal-Projekte, die Kohlendioxid wieder aus der Luft entnehmen, jetzt Emissionsrechte erzeugen. Die Anerkennung der sogenannten CCS-Projekte (Carbon Capture and Storage) war ein Hauptziel der Ölindustrie, da sie hierin bereits Milliardenbeträge investiert hat; zahlreiche Stimmen aus der Zivilgesellschaft beklagten, dass das Tor für „falsche Lösungen“ weit geöffnet sei.
Das Klima auf dem Klimagipfel
In Baku stieg im Laufe der Tage bei vielen Vertretern aus dem Globalen Süden und der Zivilgesellschaft die Unzufriedenheit mit der Präsidentschaft. Sie kulminierte am Tag der Verlängerung: Am Samstagnachmittag verließen Vertreter der AOSIS (die Inselstaaten) und Teile der LDCs, der ärmsten Länder, vorübergehend das Plenum, weil der Präsident sie nicht vor der Formulierung der Schlußversion angehört hatte. Nachher wurde bekannt, dass er Saudi-Arabien hingegen Änderungen am Text erlaubt hatte. Die kleinen Inselstaaten und die ärmsten Länder akzeptierten zuletzt doch den Text, weil es ihnen wichtiger war, dass die COP überhaupt ein Ergebnis hatte.
Im nächtlichen Plenum, nach dem Beschluß der Endversion, beschwerten sich viele Staaten, darunter Indien, Nigeria und Bolivien heftig über das undemokratische Verhalten des Präsidenten; Indien akzeptierte das Ergebnis nicht.
EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra äußerte sich zufrieden über die Ergebnisse, es begänne eine neue Ära der Klimafinanzierung und es gäbe neue Regeln für den Kohlenstoffmarkt. Die Lobbyisten der Öl- und Gasindustrie dürften auch zufrieden sein: Sie haben erreicht, was sie wollten.